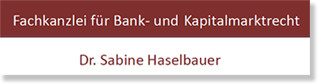Aufklärungspflichten bei Fremdwährungskrediten an Kommunen- BGH vom 19.12.2017- XI ZR 152/17
Die Kopplung von Krediten an Wechselkurse ist nicht per se sittenwidrig. Allerdings muss bei solchen Geschäften deutlich auf die Risiken hingewiesen werden, da sich sonst eine Schadensersatzpflicht ergibt.
Im entschiedenen Fall wandte sich die Klägerin- eine Gemeinde- gegen die aus ihrer Sicht zu hohen Zinsen aus ihrem Darlehensvertrag an die beklagte Bank. Im Juni 2007 hatte sie bei dem Kreditinstitut zur Ablösung eines noch laufenden Darlehens einen neuen Kredit mit einer Laufzeit von 38 Jahren abgeschlossen. Die Zinsen des Kredits sollten nach der Vereinbarung an den Wechselkurs des Euro zum Schweizer Franken gebunden sein. In den vorausgehenden Beratungsgesprächen hatte die Bank zwar weitere Möglichkeiten einer Umschuldung erläutert. Allerdings wurde die Finanzierung mit wechselkursbasiertem Zins konkret beworben. In der Tabelle war zwischen den Kursen von 1,43 und 1,42 ein fettgedruckter Trennstrich mit dem Hinweis „Barriere“ eingezeichnet, zum Wechselkurs von 1,44 erfolgte der Hinweis „Niedrigstes historisches Niveau“, zum Wechselkurs von 1,45 „Untere Schwelle des Zielkorridors der SNB“. Der Wechselkurs von 1,64 war als „Aktuelles Niveau“ ausgewiesen. Weit nach Abschluss des Vertrages wertete der Schweizer Franken dann jedoch so stark auf, dass die Zinsen auf zuletzt 18,99 Prozent im Jahr anwuchsen. Davon wollte sich die Klägerin nun lösen.
Im Ergebnis verneinte der BGH zwar eine Sittenwidrigkeit des Darlehensvertrages, bejahte demgegenüber eine Aufklärungspflichtverletzung der finanzierenden Bank:
Keine Sittenwidrigkeit des Darlehensvertrages
Die Gemeinde trug zunächst vor, dass der Darlehensvertrag aufgrund der hohen Zinsen sittenwidrig sei. Dies wurde vom BGH jedoch verneint. Denn es folge aus dem spekulativen Element der Zinsvereinbarung nichts automatisch der Umstand der Sittenwidrigkeit. Für Finanztermingeschäfte als typische Verträge mit Spiel- oder Wettcharakter müssen vielmehr weitere Umstände hinzukommen, die eine Sittenwidrigkeit begründen. Der BGH nahm hierzu Bezug auf die entwickelten Grundsätze zur Sittenwidrigkeit von Terminoptionsgeschäften und führte aus, dass eine solche nur dann angenommen werden kann wenn der Vertrag darauf angelegt ist, den Bankkunden von vornherein chancenlos zu stellen.
In der im Urteil zitierten Entscheidung des BGH vom 9. März 2010 – XI ZR 93/09 ging es hierbei um Terminoptionsgeschäfte, bei denen die verlangten Gebühren das Chancen-Risiko-Verhältnis aus dem Gleichgewicht brachten. Die dadurch verminderte Gewinnchance musste mit zunehmender Anzahl der Optionsgeschäfte weiter abnehmen. Das dortige Geschäftsmodell war also von vornherein darauf angelegt war, uninformierte, leichtgläubige Menschen als Geschäftspartner zu gewinnen und sich auf deren Kosten zu bereichern.
Diese Umstände waren jedoch nicht mit dem hiesigen Fall vergleichbar. Denn bei einem anderen Wechselkurs hätte der Darlehensnehmer selbst nur einen niedrigeren Zinssatz als den bei Vertragsschluss üblichen Marktzins zahlen müssen und sich damit bessergestellt als bei Fortführung des umgeschuldeten Darlehens. Auch wenn das Geschäft also nachteilig für den Kunden ausging, war es nicht von vornherein „chancenlos“.
Verletzung von Aufklärungspflichten
Allerdings nahm das Gericht eine Verletzung von Aufklärungspflichten an. Denn bei einem Finanzierungsberatungsvertrag trifft die finanzierende Bank gegenüber dem Darlehensnehmer die Verpflichtung zur Aufklärung über die spezifischen Nachteile und Risiken und die vertragsspezifischen Besonderheiten der empfohlenen Finanzierungsform (vgl. BGH vom 18. Januar 2005 – XI ZR 17/04). Es ist hierbei zu prüfen, ob die empfohlene Finanzierung als ein für den Darlehensnehmer geeignetes Finanzierungsinstrument anzusehen war und ob die Bank den Darlehensnehmer über die spezifischen Nachteile und Risiken und die vertragsspezifischen Besonderheiten der empfohlenen Finanzierungsform hinreichend aufgeklärt hat. Inhalt und Umfang der Beratungspflichten hängen dabei von den Umständen des Einzelfalls ab.
Der BGH führte im konkreten Fall aus, dass die Bank ihren Aufklärungspflichten unter Zugrundelegung dieses Maßstabes im Hinblick auf das Risiko eines derartigen Zinsanstiegs nicht ausreichend nachgekommen sei. Denn ein Kreditinstitut müsse den Kunden „über die spezifischen Nachteile und Risiken und die vertragsspezifischen Besonderheiten der empfohlenen Finanzierungsform“ aufklären. Es reicht hierfür nicht aus, dass die generelle Abhängigkeit von Wechselkurs und Zinshöhe aus dem Vertrag ersehbar gewesen ist. Denn maßgeblich ist, dass eine Obergrenze für die Zinsen nicht vereinbart wurde und auch innerhalb der Beratungsgespräche nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Vielmehr habe man die Risiken sogar verharmlost, weil man nur günstige Umstände wie die Politik der Schweizerischen Nationalbank und das Wechselkursniveau der vergangenen Jahre hervorgehoben habe, obwohl der Vertrag eine so lange Laufzeit habe.
Der ersatzfähige Schaden bestand im Ergebnis in der Differenz zwischen den von ihr aufgewendeten und denjenigen Kreditkosten, die ihr bei Abschluss desjenigen Darlehensvertrags entstanden wären, der zwischen den Parteien im Falle einer ordnungsgemäßen Finanzierungsberatung zustande gekommen wäre.